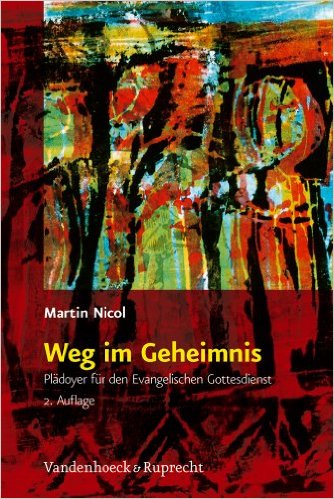
Was eine evangelische Liturgik katholischen Christen geben kann, stellt Alexander Kissler in seiner Besprechung von Martin Nicols „Weg im Geheimnis. Plädoyer für den Evangelischen Gottesdienst“ aus der heutigen Süddeutschen heraus.
Hier darf es kein „Damit“ geben und kein „Um zu“
„Wir beginnen“: Martin Nicol streitet gegen die Geringschätzung der Liturgie und für das Geheimnisvolle im evangelischen Gottesdienst
Von Alexander Kissler
Klar scheint die Lage auf dem römisch-katholischen Debattenfeld: Beständig streitet man dort über die richtige Weise, Gottesdienst zu feiern. Derzeit sieht sich die nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil erneuerte Form in der Defensive, während die tridentinische Liturgie boomt. Latein und Messaltar ziehen mehr Interesse auf sich als Volkssprache und Mahltisch. Von den Nachfahren Luthers ist dergleichen Freude am ästhetischen Räsonnement kaum überliefert. Eine gewisse liturgische Nonchalance lässt sich bis zu den Reformatoren zurückverfolgen, die den Ablauf des Gottesdienstes den sogenannten Adiaphora zurechneten – den „Dingen also und Sandlungen, mit denen man es so halten konnte oder so oder auch ganz anders“.
Martin Nicol, Professor für Praktische Theologie an der Universität Erlangen-Nürnberg, weiß, warum er den schwierigen Begriff derart flapsig übersetzt. Er sieht die evangelische Gottesdienstpraxis an einem Tiefpunkt angelangt, eben weil sie es versäumt habe, sich von dieser Geringschätzung zu befreien. Die Reformatoren, gesteht er ein, „hatten andere Sorgen“. Heute aber sei nichts dringlicher als die Rückgewinnung liturgischer Kompetenz. Nur wenn der evangelische Gottesdienst wieder deutlich mache, dass mit Gott auch das Fremde und Geheimnisvolle Platz in ihm habe, könne die Feier zur Gottesbegegnung werden. Martin Nicols leidenschaftliches Buch will den Weg dorthin weisen.
Bürgerliche Festversammlung
Von Anfang an lässt Nicol keinen Zweifel, dass er die größten liturgischen Schätze im Stollen der Vergangenheit ortet. Er reiht sich nicht ein in die modischen Verächter alles Modischen – auch die „Trivialitäten des Sakropop“ könnten ein Hoffnungszeichen werden –, wohl aber gilt seine Zuneigung den „alten Formeln und Wendungen“ und damit dem „evangelischen Gottesdienst der Tradition“. Auch hier will er ein urprotestantisches Missverhältnis gerade rücken. Es sei nachvollziehbar, dass man in den Anfangsjahren „in der Liturgik im Zweifelsfall mit der Bibel gegen die Tradition vorging“. Calvinisten und Zwinglianer fühlten sich bekanntlich zu Bildersturm, Orgelverbot und umfassender Entritualisierung ermächtigt. Längst aber habe die Scheu vor der Sakralität dazu geführt, dass die Gemeindefeier oft an eine „bürgerliche ‚Festversammlung“ erinnere. Zwei, drei oder mehr sind dann in ihrem, nicht in Jesu Namen versammelt.
Zahlreiche Fallbespiele belegen, je nach Blickwinkel, auf komischste oder erschütterndste Weise, dass das liturgische Wissen beim pastoralen Personal „weithin zu dürftig“ ist. Schwer zu besiegen ist offenbar die eitle Neigung zur Umgestaltung der Segens- und Gebetsworte. So aber werde aus der Beschwörung bloße Information, aus den Fürbitten vor Gott ein Appell an die Versammelten, aus dem Abendmahl eine zweite Predigt.
Nicol plädiert für mehr Selbstverständlichkeit statt allzu viel Verständlichkeit, um Akte „geistlicher Vergewaltigung“ zu verhindern. Eine solche liege etwa vor, wenn ein selbst formuliertes Glaubensbekenntnis das Credo ersetzt. Dann nämlich wird die Gemeinde genötigt, einen „x-beliebigen Text credomäßig mitzusprechen“, ohne dass ein Konsens der Kirche „mich auch bei Aussagen mitsprechen lässt, die ich im Glauben derzeit nicht nachvollziehen kann“.
Schleichend werde eine neue Theologie implantiert, wenn selbst das „Vater unser“ in einem Schwall warmer pastoraler Worte untergeht. Gottesdienste, die nicht im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und nicht mit einem Psalmwort beginnen, sondern mit Texten von Nelson Mandela oder Hans Dieter Hüsch, seien Realität, nicht Rarität, und eine Geistesverwirrung. Schon die einleitende Grußformel „Wir beginnen“ oder „Ich begrüße Sie herzlich“ verzerrt demnach den namenstheologischen Sinn der Formel. Viele Pastoren und Pfarren können nicht an sich halten: Sie müssen permanent erklären statt zeigen, sie reden von sich statt von der Bibel und bezeugen die eigenen Wörter statt des Worts, das laut dem Johannesevangelium am Anfang stand. Bitter urteilt Nicol über den Drang zur pastoralen Rede: „Der Kult ist verlassen, das Glaubensseminar hat begonnen.“
Gott wird Zwerg
Die liturgische Rettung erhofft er sich durch Begriffe, die eher mit der katholischen Frömmigkeit in Verbindung gebracht werden, namentlich vom Kult und der „sakramentalen Bodenhaftung des Wortes“, vom Opfer und der eucharistischen Dimension. Natürlich ist Nicol, der manche Einsicht bei Joseph Ratzinger und im katholischen Katechismus findet, kein Kryptokatholik. Auch deutet seine Anregung, dem „Gemeindegesang nach gregorianischen Vorgaben“ evangelisches Heimrecht zu geben, nicht auf eine Begeisterung für die tridentinische Messe. Er sorgt sich vielmehr um den Kern christlicher Verkündigung, die bald nicht mehr als solche erkennbar sein dürfte, wenn in Kirchen weiterhin gehandelt und geredet wird wie bei Firmenjubiläen.
Die Musik muss deshalb dienende Funktion haben und darf nicht zum Konzert werden, die Predigt sollte auch bei heiklen Fragen wie der Jungfrauengeburt und den Wundern Jesu nicht zur pädagogischen Deutung fliehen, zum „Als-ob-Modus“, und vor allem wäre die gesamte Feier parataktisch, nicht hypotaktisch zu gliedern. Nebeneinander stehen die einzelnen liturgischen Elemente, anders als etwa im Vortrag, der seine Argumente gewichtet und Hierarchien aufbaut, Kausalverbindungen knüpft. Im Gottesdienst, folgert Nicol, darf es kein „Damit“ geben und kein „Um zu“. Sonst zwingt man das Unverfügbare ins Raster allzu menschlicher Logik; Gott wird Zwerg.
Viel gewagt hat der Theologe mit diesem widerborstigen Plädoyer. Es steht im Kontrast zu den Haupttendenzen seiner Disziplin. Die Frische, mit der es Schönheit einklagt, ist ein Weckruf an die eigene Zunft. Man sollte ihn nicht routiniert überhören.
MARTIN NICOL: Weg im Geheimnis. Plädoyer für den Evangelischen Gottesdienst. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2009. 336 Seiten, 29,90 Euro.
Süddeutsche Zeitung, Nr. 139, Montag, 21. Juni 2010, Seite 11.
Das Buch von Nicol ist ein guter Anfang. „So aber werde aus der Beschwörung bloße Information, aus den Fürbitten vor Gott ein Appell an die Versammelten, aus dem Abendmahl eine zweite Predigt.“ – Gott bewahre!